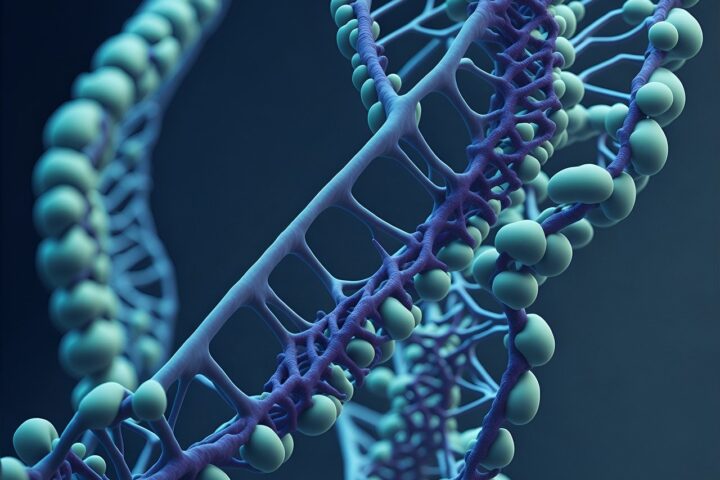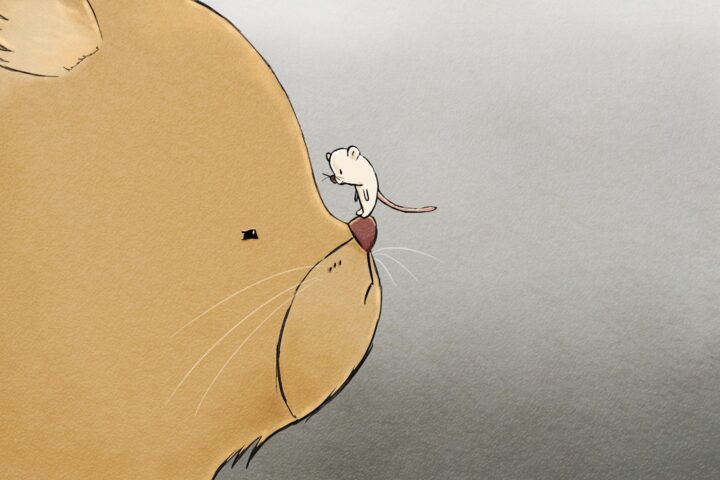Annette fragt… Bettina
Diagnose (Brust)Krebs
Sie steht da. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Sie hängte im Raum. Die Diagnose. Meine Ärztin sagte “Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Es ist Krebs, wir können ihn jedoch gut behandeln.” Ein paar Sekunden später “Haben Sie mit diese Diagnose gerechnet?”.
Der Grund dazu war, dass ich vollkommen ruhig blieb, nicht weinte oder die obligatorische Frage stellte “warum ich?”. Gerechnet nicht. Gehofft, es wäre nicht. Gewusst, es kann mich genauso treffen wie jede andere 8. Frau. Manchmal auch einen Mann. Während sie mir noch weitere Details erzählte, drehte sich in meinem Kopf eine einzige Frage. Wie sage ich das meiner Familie? Und das ist auch der Grund, wieso ich mir dieses Thema ausgesucht habe und ein paar Sätze darüber schreiben will.
Das Wichtigste zuerst: Alles, was ich hier schreibe, ist subjektiv und betrifft meine Gefühle und Empfindungen. Es ist keine Normvorgabe. Mir ist es nämlich wichtig, dass ich niemanden vom Kopf stoße oder sich jemand denkt, was schreibt sie denn da, das hat mit meiner Situation nichts zu tun. Natürlich nicht. Es ist ja auch meine Situation. Nichtsdestotrotz, bin ich überzeugt, dass es einen oder andere geben wird, die genau so empfinden wie ich.
Ich schrieb schon, dass ein paar Wochen vor meiner Diagnose mein Cousin starb. Am Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Wir alle haben das schwer verkraftet und hadern immer noch damit. Er bekam seine Diagnose im Februar oder März (ich kann mir leider fast gar nichts merken) und im Juli war er nicht mehr da. Das war der letzte Mensch, der mir sehr nahe stand und den ich am Krebs verlor.
Bei meinem ersten Treffen mit Krebs als Angehörige war ich noch ein Teenager. Meiner Cousine ging es nicht gut. Sie war gerade in Pubertät und auf einmal bekam sie ständige Kopfschmerzen und musste sich öfters übergeben. Die Hausärztin meinte, sie würde abnehmen wollen und sich deswegen übergeben. Sie solle Tee trinken und dann wird das Unwohlsein schon vergehen. So ging das ein Jahr lang, bis meiner Tante der Kragen platzte und sie auf der Stelle eine MRT- Überweisung verlangte.
Da stellte sich sofort heraus, es handelt sich um einen Gehirntumor. Uns Kinder wurde damals nicht genau gesagt, wie schlimm es um sie stand. Wir dachten, sie wurde operiert, sie bekam Chemotherapie, wurde bestrahlt und damit wäre die Krankheit erledigt. War sie ja auch, für zwei, drei Jahre. An den schlechten Ausgang dieser Krankheit dachten wir Kinder damals nicht. Mit 18 Jahren, die ich zählte, bist du unsterblich.
Dem ist es leider nicht so. Nach ein paar Jahren fingen die Probleme an. Zuerst kleine, und dann wurden sie immer größer. Ob sie nun ein Rezidiv hatte oder es tatsächlich “nur” die Nebenwirkungen der Therapie waren, wie es uns gesagt wurde, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es ist heute auch nicht mehr wichtig. Sie ist leider nicht mehr da und es ändert nichts an der Sache. Ich will sowieso auf etwas anderes hinaus. Mir geht es darum, wie es für mich war, hilflos daneben zu stehen und nicht eingreifen können.
Zuzuschauen wie sie leidet, das war schwer. Nichts tun können, um dieses Leid zu vermindern, das war noch schwerer. Machtlosigkeit. Ein Mensch leidet und wir können nicht einschreiten. Wir verlieren die Kontrolle.
Meine Mutter starb ebenfalls am Krebs. Bei ihr ging es sehr schnell. Mitte September bekam sie ihre Diagnose und Ende Dezember starb sie. Klatskintumor. Im Volksmund Gallengangkrebs genannt. Trotzdem war sie in diesen letzten drei Monaten bettlägerig. Ein Zustand, den sie gehasst hat. Und den konnte ich ihr nicht abnehmen.
Bei meinem Mann war es kein Krebs, sondern ein Arbeitsunfall. Trotzdem oder gerade deshalb (es geht mir um das Thema) will ich darüber ein paar Sätze hier schreiben. Er war, fast auf den Tag genau, 8 Monate im Spital. Zuerst 4 Wochen im künstlichen Tiefschlaf und dann noch vier Wochen der Aufwachphase. Irgendwann wurde er auf die chirurgische Station überstellt und dann wieder zurück auf die Intensiv. Hin und her, acht Monate lang, je nach dem Zustand und bedarf. Ich fuhr jeden Tag aus Wien nach Wiener Neustadt. Es ist nicht weit, etwa 40 km und die öffentlichen Verbindungen sind gut, damals wie heute.
Dennoch: Manchmal wünschte ich mir, nicht dort auszusteigen, sondern einfach weiter zu fahren und nicht mehr zurückkommen. Nicht weil ich nicht mehr wollte, ich wollte es ja und deshalb fuhr ich ja hin. Es war diese Zerrissenheit, dort sein zu wollen, und trotzdem nichts tun zu können. Diese Ohnmacht zu spüren und akzeptieren, machte mich fassungslos und endlos traurig. Als sein Weg dann zu Ende war, wusste ich, er muss nicht mehr leiden. Und ich auch nicht.
Und jetzt diese Diagnose bei mir. Ich ertrage sie leichter als ich mir das je gedacht hätte. Es gibt viel zu erledigen und ich handle die ganze Zeit. Klar gibt es hier und dort einen trüben Gedanken, jedoch ist er nicht die ganze Zeit präsent. Wenn jedoch Menschen, die wir gerne haben, betroffen sind, dann können wir selten handeln (im Sinne von medizinisch helfen). Uns sind, was das angeht, die Hände gebunden. Wenn wir die Möglichkeit haben, können wir sie zu ärztlichen Terminen begleiten, ihnen Kraft und Trost spenden. Zuhören. Ihre Sorgen erzählen lassen. Oder einfach zusammen schweigen. Damals, vor 17 Jahren, als mein Mann seine depressive Phase im Krankenhaus hatte, schwiegen wir oft sechs oder sieben Stunden lang.
Als ich mit meiner Krebsdiagnose konfrontiert wurde, begriff ich, dass ich viel leichter mit ihr umgehen kann, wenn ich betroffen bin. Weil ich gezwungen bin zu handeln. Es gibt nämlich nur zwei Optionen. Entweder handle ich oder lasse mich hängen. Wie sich die Krankheit entwickeln wird, das habe ich nicht in der Hand, jedoch ist es meine Entscheidung, wie ich ihr begegnen werde.
Andererseits wundert mich nicht, wenn sich bei so einer Diagnose plötzlich Freunde oder Familienmitglieder verabschieden. Dafür können sie nichts. Ihnen fehlt einfach die Kraft, sich damit auseinander zu setzen. Krebs ist nicht ansteckend, genau so wenig wie ein Schlaganfall, Herzinfarkt oder ein Arbeitsunfall. Es verlangt jedoch viel von menschlicher Stärke, physisch und psychisch, da zu sein und helfen. Selbst wenn man sich nur anschweigt.
Wir sind stark und wollen leben, stärker als so mancher denkt. Und doch brauchen wir manchmal Hilfe. Um einfach krank sein zu können und dürfen, und sich nicht verstellen zu müssen. Wenn ich schwach bin, dann bin ich schwach, und wenn jemand das nicht ertragen kann, dann ist es besser, mich nicht zu sehen, weil so zu tun, als würde es mir blendend gehen, während ich mich am liebsten tot stellen würde, das geht nicht. Damit ist mir nicht gedient.
Und doch verstehe ich jeden, der damit ringt, weil ich weiß wie es ist, sich hilflos zu fühlen und nur zuschauen zu können, aber nicht eingreifen. Und wenn sie dann versuchen, mich manchmal in die Watte zu packen, dann lasse ich das über mich ergehen, genieße es und lächle dabei. Sie tun das mit uns, weil sie uns lieben.
Ja, die Diagnose Krebs, die macht schon etwas mit dir. Plötzlich sehe ich mehrere Blickwinkeln einer Situation und begreife, dass mir diese Diagnose bei mir nicht so viel Angst macht, wie wenn es um die Menschen in meinem Umfeld ging. Ich lerne damit zu leben. Es wäre gelogen zu sagen, dass ich angstfrei bin. Mein Bonus ist (so blöd sich das anhört), dass ich schon wiederbelebt wurde. Das heißt, ich könnte schon seit über sechs Jahren das Gras von der anderen Seite betrachten (schwarzer Humor, ohne den geht bei mir gar nichts). Deswegen ist jeder Tag, den ich lebe, Jackpot für mich.
Natürlich mache ich mir ab und zu Gedanken, schließlich liegt mir etwas an meinem Leben, denn eilig habe ich es nicht.Mir ist klar, dass es jederzeit wieder irgendetwas sein könnte (Gott behüte), aber so weit denke ich nicht. Wozu sich im Voraus Sorgen machen über etwas, was man eh nicht in eigenen Händen hat? Und außerdem: Meine Ärztin meinte, ich hätte einen Schutzengel. Ich vertraue ihm.
Abschließend liegt mir noch Folgendes auf dem Herzen, was ich sagen möchte:
Liebe/r Angehörige/r, wenn du dir nächstes Mal große Sorgen machst, dann atme tief durch und lehne dich ein bisschen zurück. Wir tun was wir können und wissen, ihr würdet uns am liebsten heilen, nur geht das leider nicht. Ein “Ich bin für dich da” hilft uns schon sehr viel. Wir machen alles, was in unserer Macht steht, um diese Krankheit zu besiegen.
Und du liebe/r Betroffene/r, solltest du dich in Zukunft wieder mal schuldig fühlen, weil sich deine Familie und Freunde so sehr um dich kümmern, und du schon wieder an der ersten Stelle bist, und alles sich (SCHON WIEDER!) um deine Krankheit dreht, lass es. Sie tun das weil sie dich lieben. Wenn sie könnten, würden sie dir deine Schmerzen nehmen und diese für dich ertragen. Du würdest an ihrer Stelle genau so machen. Wenn es dir dann wieder besser geht, kannst du sie verwöhnen und ihnen damit zeigen, wie glücklich du bist, sie zu haben.
So weit meine Erfahrung.
Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal
Miri